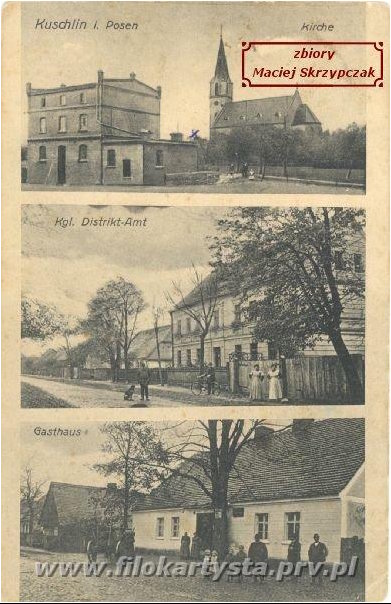Woydt
* 10.02.1819 Kurowo
+ 04.03.1874 Forsthaus Eichenhorst
Schiller
* 02.11.1823 Sworzyce
+ ?

Woydt
Brennereiinspektor in Sliwno, später Verwalter des Seemannsheimes der Kriegsmarine in Kiel
* 16.02.1845 Forsthaus Bukowiec (Kr. Grätz)
+ ?
|
Gottlieb Heinrich Carl Woydt * 25.04.1871 Sliwno (Kr. Grätz) + 14.10.1943 Rickling |
Arthur Max Erich Woydt * 28.03.1882 Sliwno + ? |